Rutschsicherheit = Rechtssicherheit
Rutschsicherheit und Verkehrssicherungspflicht
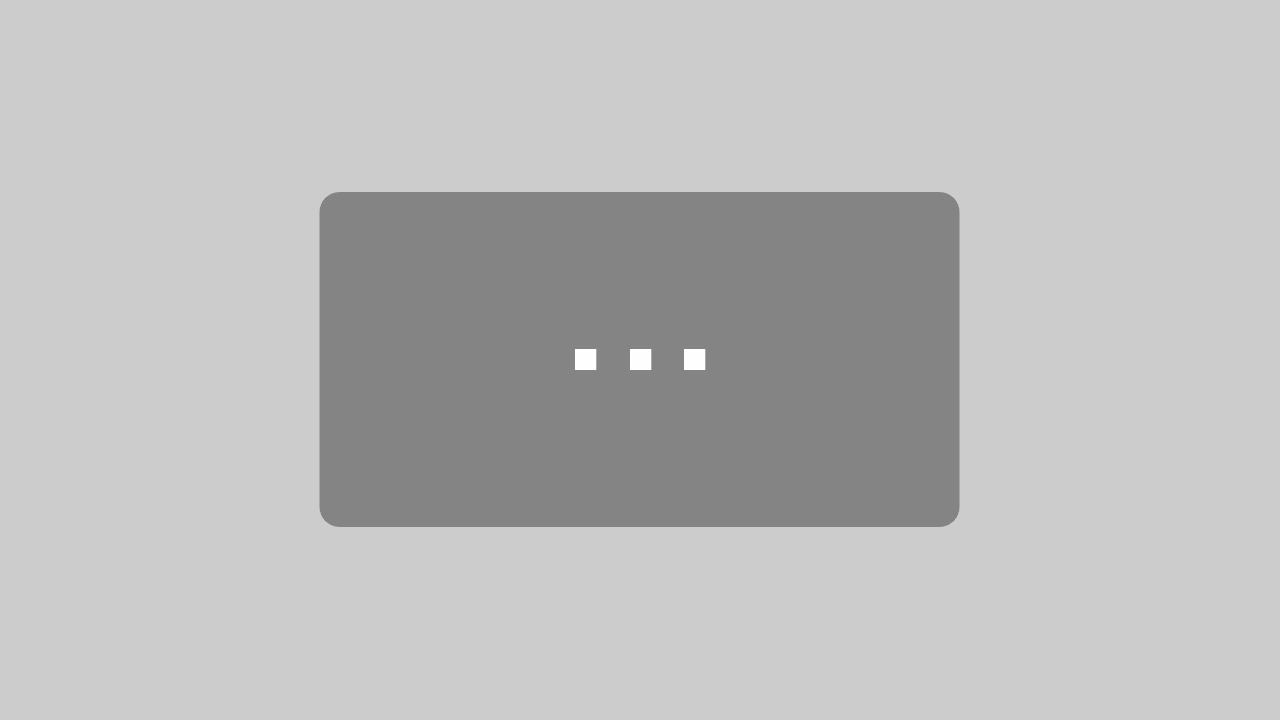
Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Verkehrssicherungspflicht
- Rechtsgrundlage: Abgeleitet aus § 823 BGB Schadensersahtzpflicht, und verschiedenen Arbeitsschutz und Unfallverhütungsvorschriften
- Die Verkehrssicherungspflicht in Deutschland besagt, dass derjenige, der eine Gefahrenquelle schafft oder unterhält, dafür sorgen muss, dass Dritte nicht durch diese Gefahrenquelle zu Schaden kommen.
- Dies gilt insbesondere für Eigentümer, Betreiber und Verantwortliche von Gebäuden und Arbeitsplätzen.
Unfallstatistik
- 25% aller Arbeitsunfälle sind Stolper-, Rutsch- und Sturzunfälle.
- 50.000 Unfälle pro Jahr erfordern stationäre Behandlung.
- 4.800 Menschen erleiden Dauerschäden.
- 35 tödliche Unfälle jährlich.
Bezug zur Rutschsicherheit
- Unternehmen müssen rutschhemmende Bodenverhältnisse sicherstellen, um Stürze und Unfälle zu vermeiden.
- Arbeitsstättenverordnung: Fußböden müssen trittsicher, rutschhemmend und leicht zu reinigen sein.
- Bei Vernachlässigung kann der Geschäftsführer persönlich haften und mit
- Schadensersatzforderungen, Bußgeldern oder sogar strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.
- Berufsgenossenschaften und Versicherungen können im Schadensfall Regressansprüche stellen.
Wer haftet im Schadensfall
- Eigentümer von Gebäuden und Arbeitsstätten
- Mieter und Pächter, wenn die Instandhaltungspflicht vertraglich übertragen wurde.
- Hausverwaltungen sind für Instandhaltung und Sicherheit verantwortlich, bei nachgewiesener persönlicher Verantwortung, haftet der Geschäftsführer
- Facility Manager übernehmen die operative Umsetzung von Instandhaltung und Sicherheit, kann persönlich belangt werrden, Hauptverantwortung liegt beim Auftraggeber
- Unternehmer und Arbeitgeber, wenn Arbeitnehmer und Kunden betroffen sind
Strafmaß beim verletzten der Verkehrssicherungpflicht
- § 823 BGB: Schadensersatzpflicht bei fahrlässiger Verletzung.
- Fahrlässige Körperverletzung (§ 229 StGB): Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahre.
- Fahrlässige Tötung (§ 222 StGB): Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahre oder Geldstrafe.
- Vorsätzliche Körperverletzung (§ 223 StGB): Bis zu 5 Jahre Freiheitsstrafe bei bewusster Gefährdung.
Bewertung der Rutschsicherheit
- Ein Boden kann im Laufe der Jahre seine rutschhemmenden Eigenschaften verlieren durch:
- Abnutzung durch Nutzung. Schleichende Verglättung
- Rückstände von Reinigungs- und Pflegemitteln.
- Unsachgemäße Reinigungs- und Pflegemethoden
- Es besteht die Pflicht dies zu kontrollieren und für ausreichende Sicherheit zu sorgen.
Unser Service zum Thema Rutschsicherheit
- Rechtssichere Messung & Bewertung vor Ort.
- Erstellung eines Prüfberichts mit Maßnahmenkatalog.
- Kategorisierung:
- - A: Kritisch – Dringende Maßnahmen erforderlich.
- - B: Eingeschränkt betriebstauglich – Verbesserungen notwendig.
- - C: Uneingeschränkt betriebstauglich.
- Angebot von Wartungsverträgen für regelmäßige Überprüfung.
Fazit zum Thema Rutschsicherheit
- Rutschsicherheit ist entscheidend zur Unfallprävention.
- Rechtliche Vorgaben müssen strikt eingehalten werden.
- Unternehmen sollten proaktiv Maßnahmen zur Gefahrenreduktion ergreifen.
- Regelmäßige Prüfungen erhöhen die Sicherheit und reduzieren Haftungsrisiken.
Häufig gestelllte Fragen zum Thema Rutschsicherheit
Entspricht ein geschliffener Naturstein C120 immer einer R9?
Der Deutsche-Naturstein-Verband (DNV) schreibt in der Broschüre "Rutschsicherheit von Bodenbelägen aus Naturwerkstein", dass "nach den bisherigen Erfahrungen davon auszugehen ist, dass Natursteinfußbodenbeläge mit der Oberflächenbearbeitung "geschliffen C120" sowohl in trockenem als auch in nassem Zustand für die Verwendung in Eingangsbereichen, die direkt aus dem Freien betreten werden, wie beispielsweise Schalterräume von Geldinstituten, ausreichend rutschhemmend sind."
In der Aktualisierung der BGR-181 im Oktober 2003 wurde der Akzeptanzwinkel von 3 Grad auf 6 Grad angehoben, somit ist die Aussage des DNV nicht mehr allgemein gültig.
Für geschliffene Natursteine muss im Einzelfall geprüft werden, welcher Schliff den neuen Anforderungen entspricht. Besonders bei dunklen Gesteinen ist mit einem gröberen Schliff zu rechnen.
Kann man gebürstete Natursteine im Außenbereich verlegen (R11 oder R10 V4)?
Gebürstete Natursteinbeläge entsprechen in der Regel nur einer R10 und sind somit nicht ausreichend rutschhemmend (Im Einzelfall ist dies zu überprüfen). Besser ist es geflammt, gestockt oder gesandstrahlt einzubauen.
Sollte im Eingangsbereich eine Sauberlaufmatte eingeplant werden?
Ja. Zur Vermeidung des Einschleppens von Schmutz und Feuchtigkeit ist es wichtig, an den Gebäudeeingängen ausreichend dimensionierte Sauberlaufzonen mit Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern anzuordnen. Diese sollten über die gesamte Durchgangsbreite und in Laufrichtung mindestens 1,50 m lang so verlegt sein, dass sie nicht verrutschen können und keine Stolperstellen bilden.
Welche Regelung gilt für Nasszellen (z. B. in Sanitärräumen) und was ist zu berücksichtigen, wenn nassbelastete Arbeitsbereiche nicht nur barfuß sondern auch mit Schuhen begangen werden?
Nach Auffassung des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen" und des Fachausschusses "Bauliche Einrichtungen" werden Nasszellen in der Regel barfuß begangen. Das bedeutet, dass die Anforderungen an die Rutschhemmung von Böden in Nasszellen durch die GUV-I 8527 geregelt werden.
Die Frage, ob die GUV-I 8527 oder die BGR 181 als Regelwerk zum Tragen kommt, hängt grundsätzlich davon ab, ob der Arbeitsbereich barfuß (GUV-I 8527) oder mit Schuhen (BGR 181) begangen wird.
Werden Arbeitsbereiche wechselweise barfuß und mit Schuhen begangen, sind beide Regelwerke zu berücksichtigen. Der Grund hierfür liegt neben organisatorischen Maßnahmen des Betriebes in der Prüfung der Rutschhemmung. Die Prüfmethoden, DIN 51097 (barfuß) und DIN 51130 (Schuh), liefern keine vergleichbaren Werte, obwohl sie die gleiche Prüfeinrichtung, die "Schiefe Ebene", benutzen. Nach der DIN 51097 wird nämlich die Rutschhemmung des Bodenbelags mit Wasser und barfuß geprüft, im Fall der DIN 51130 erfolgt die Prüfung jedoch mit Öl und Schuhen.
Habe ich alles Notwendige getan und bin ich rechtlich auf der sicheren Seite, wenn ein R9-Bodenbelag eingebaut wurde?
Nein, Sie haben bis dahin alles richtig gemacht. Jedoch ist ein einmal eingebrachter Boden R9 nicht gleichzeitig immer R9. Ihre Pflicht ist es dieses aber zu überwachen. Die Ursachen können sehr vielseitig sein:
Eine falsche Reinigung mit seifenhaltigen, schichtaufbauenden Reinigern kann die Rutschsicherheit stark vermindern.
Eine Abnutzung im normallaufenden Geschäftsbetrieb ebenso, man spricht hier von einer schleichenden Verglättung. (Unter dem Mikroskop sieht der Belag aus wie eine Berg- und Tal Landschaft. Im Laufe der Zeit laufen sich die Bergspitzen ab und in den Tälern sammelt sich Mikroschmutz. Dies führt zu einer Verglättung.)
Als Betreiber und Eigentümer sind Sie dazu verpflichtet, gemäß Arbeitsstättenverordnung, berufgenossenschaftlichen Richtlinien und der Verkehrsicherungspflicht, den Boden in einem einwandfreien, rutschsicheren Zustand zu erhalten.
Wie soll Ich die Rutschsicherheit überprüfen?
Die Überprüfung der R-Werte kann ausschließlich stationär erfolgen, d.h. Sie müssten jedes mal ca. 1 qm Boden ausstemmen und in ein Prüfinstitut schicken. Dort kann der Boden getestet werden. Und Sie können durch Vergleich des Akzeptanzwinkels eine Aussage über die Veränderung der Rutschsicherheit treffen.
Gibt es keine andere Möglichkeit, die Rutschsicherheit vor Ort zu prüfen?
Doch, gemäß DIN 51131 ist eine Messung der Rutschsicherheit auch stationär, bei Ihnen vor Ort möglich, ohne den Boden heraus zu reißen.
Hierbei wird ein µ-Wert ermittelt, welcher sich durch berufsgenossenschaftliche Richtwerte für die Rutschhemmung von Böden im Betriebszustand (Beschluss des FABE vom 30.11.2004)einteilen lässt.
Dieser Wert reicht dann also aus, um die Rutschsicherheit zu überprüfen und mit den R-Werten zu vergleichen?
Leider nein. Es gibt keine Korrelation zwischen den R-Werten und den µ-Werten, d. h. man kann Sie nicht miteinander vergleichen. DIN 51130 und DIN51131 basieren auf völlig verschiedenen Prüfverfahren.
Wann sollte eine Reinigung im Innenbereich erfolgen?
Die Reinigung und Pflege soll so vorgenommen werden, dass sie in der verkehrsarmen Zeit erfolgt, um eine Rutschgefahr zu vermeiden. Feucht gereinigte Bereiche sind durch das Warnzeichen W28 „Warnung vor Rutschgefahr“ nach der Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV-V A 8, bisher GUV 0.7) zu kennzeichnen, solange die Rutschgefahr besteht.
Was ist im Außenbereich zu beachten?
Für Außenbereiche sind besondere Gefahren durch Eis und Schnee gegeben. Deshalb ist frühzeitiges , also unmittelbares oder spätestens zu Arbeitsbeginn, Schneeräumen und Streuen, insbesondere der Verkehrswege unerlässlich.
Bei der Glättebekämpfung haben sich sowohl auftauende wie auch abstumpfende Stoffe bewährt. Der Einsatz auftauender Stoffe setzt immer eine sorgfältige Schneeräumung voraus. Die Schneeräumung wird andererseits auch erleichtert, wenn bereits bei einsetzendem Schneefall Tausalz gestreut wird.
Als abstumpfende Stoffe werden Asche, Holzspäne, Sand, Kies, Splitt oder Industriegranulate verwendet. Hier besteht jedoch nach Abtauen der Glätte Rutschgefahr durch das frei liegende Streugut. Das Streugut ist deshalb anschließend sofort zu entfernen. Wann in öffentlichen Bereichen zu räumen und zu streuen ist, wird durch die örtlichen behördlichen Vorschriften über die Verkehrssicherungspflicht geregelt.
Sollte ein Mitarbeiter auf Schmutz oder Streumitteln auf dem Betriebsgelände ausrutschen, so kann die Unfallkasse die Behandlungskosten von der Firma ganz oder teilweise zurückverlangen. Wenn Kunden stürzen, kann die Betriebshaftpflicht sie ebenfalls an den Behandlungskosten beteiligen. Die BGR 181 ist dann der anerkannte Stand der Technik, den sie sozusagen sträflich vernachlässigt haben. Des weiteren haben Sie Ihre Vehrkehrssicherungspflicht vernachlässigt.
Für Fliesenleger & Verarbeiter
Im Moment bereiten wir die Inhalte für diesen Bereich vor. Um Sie auf gewohntem Niveau informieren zu können, werden wir noch ein wenig Zeit benötigen. Bitte schauen Sie daher bei einem späteren Besuch noch einmal auf dieser Seite vorbei. Vielen Dank für Ihr Interesse!
Was muß Ich bei der Planung oder Renovierung eines Bodenbelages in einem öffentlichen Gebäude oder einem Arbeitsbereich beachten?
Für die Auswahl ist es wichtig, sich alle Anforderungen bewusst zu machen, denen der künftige Bodenbelag entsprechen soll. Es muss also nicht nur geprüft werden, ob der vorgesehene Bodenbelag für den Verwendungsbereich ausreichende Rutschhemmung besitzt, sondern man sollte sich auch vergewissern, ob die mechanische Festigkeit des Bodenbelags, die Beständigkeit gegen chemische und physikalische Einwirkungen sowie die Haftung des Bodenbelages auf dem Untergrund den zu erwartenden Belastungen standhalten. Bei der Auswahl der Bodenbeläge sollte auch die Art des späteren Reinigungsverfahrens berücksichtigt werden.
Welche Regelung gilt für Nasszellen (z. B. in Sanitärräumen) und was ist zu berücksichtigen, wenn nassbelastete Arbeitsbereiche nicht nur barfuß sondern auch mit Schuhen begangen werden?
Nach Auffassung des Kuratoriums "Rutschhemmende Bodenbeläge in nassbelasteten Barfußbereichen" und des Fachausschusses "Bauliche Einrichtungen" werden Nasszellen in der Regel barfuß begangen. Das bedeutet, dass die Anforderungen an die Rutschhemmung von Böden in Nasszellen durch die GUV-I 8527 geregelt werden.
Die Frage, ob die GUV-I 8527 oder die BGR 181 als Regelwerk zum Tragen kommt, hängt grundsätzlich davon ab, ob der Arbeitsbereich barfuß (GUV-I 8527) oder mit Schuhen (BGR 181) begangen wird.
Werden Arbeitsbereiche wechselweise barfuß und mit Schuhen begangen, sind beide Regelwerke zu berücksichtigen. Der Grund hierfür liegt neben organisatorischen Maßnahmen des Betriebes in der Prüfung der Rutschhemmung. Die Prüfmethoden, DIN 51097 (barfuß) und DIN 51130 (Schuh), liefern keine vergleichbaren Werte, obwohl sie die gleiche Prüfeinrichtung, die "Schiefe Ebene", benutzen. Nach der DIN 51097 wird nämlich die Rutschhemmung des Bodenbelags mit Wasser und barfuß geprüft, im Fall der DIN 51130 erfolgt die Prüfung jedoch mit Öl und Schuhen.
Für die Bewertung der Rutschhemmung von Bodenbelägen für sowohl barfuß, als auch mit Schuhen begangene Arbeitsbereiche, werden deshalb beide Prüfmethoden herangezogen. Der Bodenbelag in einem Sanitärraum, der z. B. als Waschraum und als Umkleideraum dient und barfuß und mit Schuh begangen wird, sollte dann die Bewertungsgruppe "A" nach GUV-I 8527 und die Bewertungsgruppe "R 10" nach BGR 181 aufweisen.
Dieser Wert reicht dann also aus, um die Rutschsicherheit zu überprüfen und mit den R-Werten zu vergleichen?
Leider nein. Es gibt keine Korrelation zwischen den R-Werten und den µ-Werten, d. h. man kann Sie nicht miteinander vergleichen. DIN 51130 und DIN51131 basieren auf völlig verschiedenen Prüfverfahren.
Wann sollte eine Reinigung im Innenbereich erfolgen?
Die Reinigung und Pflege soll so vorgenommen werden, dass sie in der verkehrsarmen Zeit erfolgt, um eine Rutschgefahr zu vermeiden. Feucht gereinigte Bereiche sind durch das Warnzeichen W28 „Warnung vor Rutschgefahr“ nach der Unfallverhütungsvorschrift „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (GUV-V A 8, bisher GUV 0.7) zu kennzeichnen, solange die Rutschgefahr besteht.
Was ist im Außenbereich zu beachten?
Für Außenbereiche sind besondere Gefahren durch Eis und Schnee gegeben. Deshalb ist frühzeitiges , also unmittelbares oder spätestens zu Arbeitsbeginn, Schneeräumen und Streuen, insbesondere der Verkehrswege unerlässlich.
Bei der Glättebekämpfung haben sich sowohl auftauende wie auch abstumpfende Stoffe bewährt. Der Einsatz auftauender Stoffe setzt immer eine sorgfältige Schneeräumung voraus. Die Schneeräumung wird andererseits auch erleichtert, wenn bereits bei einsetzendem Schneefall Tausalz gestreut wird.
Als abstumpfende Stoffe werden Asche, Holzspäne, Sand, Kies, Splitt oder Industriegranulate verwendet. Hier besteht jedoch nach Abtauen der Glätte Rutschgefahr durch das frei liegende Streugut. Das Streugut ist deshalb anschließend sofort zu entfernen. Wann in öffentlichen Bereichen zu räumen und zu streuen ist, wird durch die örtlichen behördlichen Vorschriften über die Verkehrssicherungspflicht geregelt.
Sollte ein Mitarbeiter auf Schmutz oder Streumitteln auf dem Betriebsgelände ausrutschen, so kann die Unfallkasse die Behandlungskosten von der Firma ganz oder teilweise zurückverlangen. Wenn Kunden stürzen, kann die Betriebshaftpflicht sie ebenfalls an den Behandlungskosten beteiligen. Die BGR 181 ist dann der anerkannte Stand der Technik, den sie sozusagen sträflich vernachlässigt haben. Des weiteren haben Sie Ihre Vehrkehrssicherungspflicht vernachlässigt.
Für Privatpersonen
Rutschsicherheit gilt nur im öffentlichen Bereich. Privat kann Ich doch machen was mir gefällt?
Nein, denn es gibt in Deutschland die Verkehrssicherungspflicht.
Verkehrsicherungspflicht:
- Jeder, der durch sein Tun oder Unterlassen eine Gefahrenquelle geschaffen hat, ist dazu verpflichtet, Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die zur Abwendung eines Schadens von Personen und Sachen erforderlich sind.
- Richtungweisend können die Regelungen des § 823 BGB gelten: "Wer ... fahrlässig ... verletzt, ist zum Ersatze des daraus entstehenden Schadens verpflichtet." Schlüsselwort ist dabei "fahrlässig", was auf § 276 Abs. 1 Satz 2 BGB verweist: "Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht lässt."
Der Eingangsbereich auch bei Einfamilienhäusern ist öffentlicher Verkehrsraum, wenn er z. B. vom Postboten betreten werden muss. Er muss also auch die entsprechende Rutschhemmung aufweisen.
Auch wenn man Freunde zu einem Saunabesuch zu Hause einlädt und dort kommt es zu einem Rutschunfall greift die Vernachlässigung der Verkehrsicherungspflicht
Gleiches gilt auch auf Terrasse, wo der Einbau von poliertem Material als grob fahrlässig einzustufen ist.
Was ist im Außenbereich im Winter zu beachten?
Räum- und Streupflicht:
Außenbereiche sind vor Arbeitsbeginn vom Schnee zu befreien oder abzustumpfen. Nach der Abtauung ist das abstumpfende Mittel zu entfernen. Laub, starke Bemoosung und Schmutz muss außen entfernt wird. Sollte jemand bei Ihnen stürzen machen Sie sich straffällig, durch Verletzung Ihrer Verkehrssicherungspflicht.
- Übertragung auf die Anlieger zulässig (Gemeindesatzung verpflichtet Eigentümer der an der Straße angrenzenden Grundstücke)
- Umfang der Streupflicht richtet sich danach, was zur gefahrlosen Benutzung des Bürgersteiges erforderlich ist
- Schneeräumzeit zw.7 Uhr morgens und 21 Uhr
- Für einen Schadenersatz gegenüber den verunglückten Fußgängern haften die Wohnungseigentümer als Gesamtschuldner
- Bis 10.000 € Schmerzensgeld bei Sturz auf nicht gestreuten Gehweg
- Eine Frau war auf einem eisglatten Bürgersteig ausgerutscht, weil ein Vermieter und dessen Hausmeister nicht gestreut hatten. Dabei hatte sie sich ein Handgelenk gebrochen. Ihre Erwerbsfähigkeit war seitdem um zehn Prozent gemindert. Das Amtsgericht Frankfurt a.M. sprach der Frau ein Schmerzensgeld in Höhe von 10.000 DM zu. Die Klägerin habe unter der schmerzhaften Verletzung und der jahrelangen Heilbehandlung viel zu leiden, heißt es in der Begründung.
- Der Gehweg muss erst ab 7:00 Uhr morgens geräumt sein - Ein Mann war beim Verlassen seines Wohnhauses um 06:05 Uhr auf dem vereisten Gehweg ausgerutscht und hatte sich dabei verletzt. Daraufhin hatte er den Hauseigentümer verklagt. Die Richter des Düsseldorfer OLG wiesen die Klage ab. Sie befanden: Für einen Vermieter sei es unzumutbar, seine Nachtruhe vor 06:00 Uhr zu unterbrechen, um den Gehweg zu räumen. Es reiche aus, erst um 07:00 zu streuen.
- Winterdienst - Für die Nichtbeachtung der Streu- und Räumpflicht gibt es keine Entschuldigung. Berufstätige müssen tagsüber notfalls für eine Vertretung sorgen, falls sie ihrer Streupflicht nicht nachkommen können. Das Gleiche gilt, wenn der Streupflichtige im Winter in Urlaub fährt.
Vor dem Einbau
Architekten, Planer und Betreiber können sich schon in der Planungsphase Rechtssicherheit für einen zertifizierten (R9 oder R10), polierten Boden sichern, indem eine werkseitige Bearbeitung des Bodenbelags mit -ausgeschrieben oder -ausgeführt wird.
Gutachten zum Thema Rutsicherheit
Dieses wird z.B. bei folgenden Punkten notwendig:
- Ursachenprüfung bei Unfällen oder Beinaheunfällen;
- Wenn beim Begehen ein Boden subjektiv als "rutschig" erscheint
- Vorher-/Nachher-Prüfungen, bei vor Ort hergestellten Oberflächen oder im Anschluss an eine Nachbehandlung
- Änderung des Reinigungsverfahrens;
- Soll-/Ist-Vergleichsprüfungen zur Feststellung von Unterschieden zwischen dem Neu- und Betriebszustand;
- Nutzungsänderung
- Wirksamkeitskontrolle von der getroffenen Maßnahmen zur Verbesserung oder Erhaltung der Rutschsicherheit
Sie erhalten von uns eine eindeutige Stellungnahme bzgl. der Rutschsicherheit Ihres Bodenbelags gemäß der vorhandenen berufgenossenschaftlichen Richtlinien und Verordnungen. Dabei werden neben der Messung der Rutschsicherheit auch die spezifischen Nutzungsbedingungen und sämtliche Einflussfaktoren mit Ihren Folgen und Auswirkungen auf die Rutschhemmung berücksichtigt. Anhand eines Rutschhemmungskatasters helfen wir Ihnen bei der Überwachung der Rutschsicherheit.
Mit der neuen Berufgenossenschaftlichen Information DGUV I-8687 kann dadurch ein Konzept installiert werden welches Ihnen zu jederzeit Rutschicherheit und Rechtssicherheit bietet.